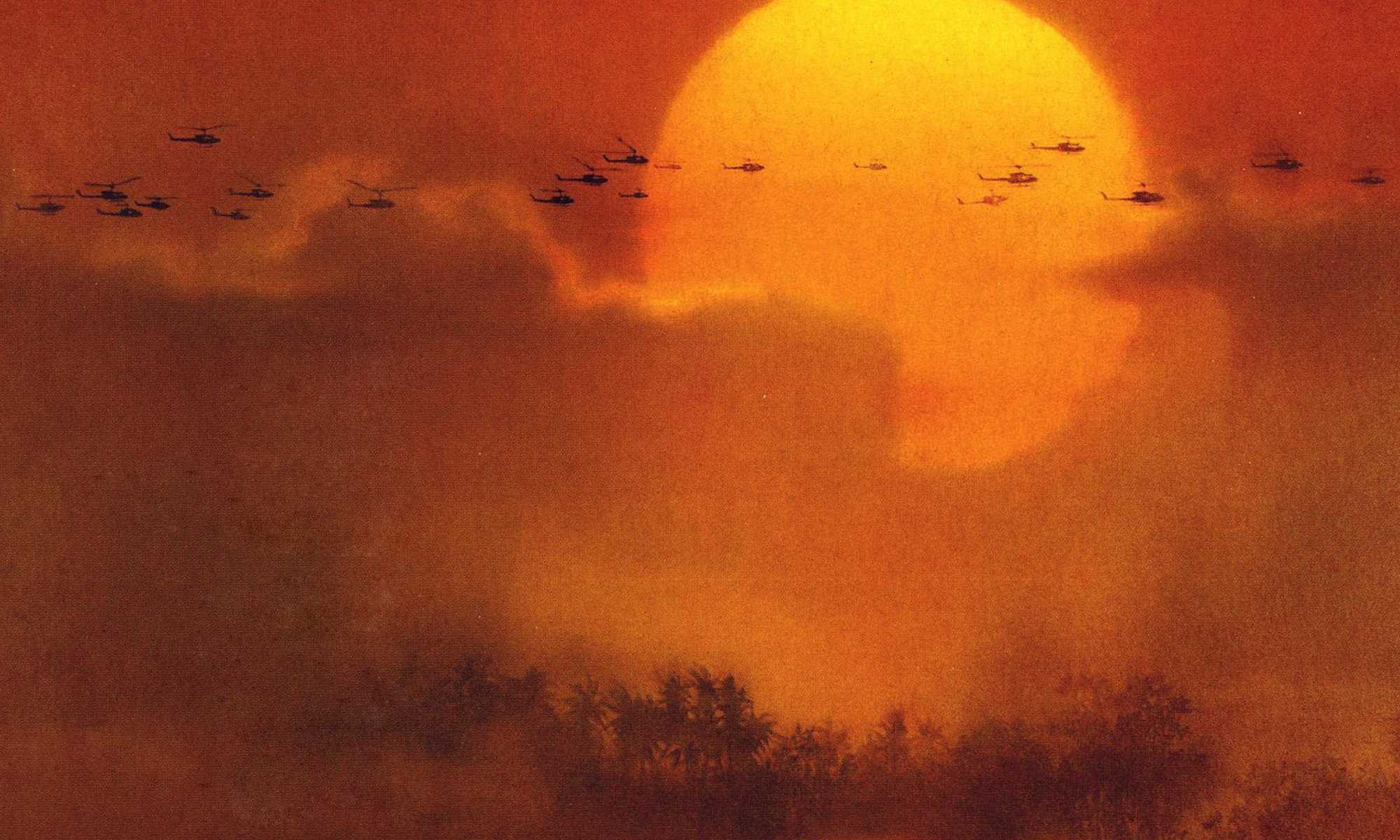Markus Schleinzer kommt aus der Haneke-Schule, daran lässt dieser Film keinen Zweifel. Kühl, distanziert, methodisch, pedantisch und präzise, wie die Titelfigur, handelt der Film seine Geschichte ab: Die letzten Wochen eines Mannes mit dem Zehnjährigen, den er in seinem Keller gefangen hält. Das sei keine verklausulierte Natascha-Kampusch-Geschichte, insistiert der Regisseur, und damit hat er bestimmt recht. Aber es ist ein Film aus Österreich, die Geschichte eines Mannes und eines im Keller des Mannes gefangenen Kindes. Dabei bleibt dem durchschnittlich aufmerksamen Zuschauer lange verborgen, welcher der beiden den Namen Michael trägt. Und wenn es dann klar wird, sind wir schon so weit, dass wir den Mann als Menschen erkannt haben, widerwillig, zwangsläufig.